Baukulturwerkstatt März 2014
Öffentlicher Raum und Infrastruktur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
Am 29. März 2014 begrüßt der Vorstandsvorsitzende der Bundesstiftung Baukultur, Reiner Nagel, gut 300 Teilnehmer zur zweiten Baukulturwerkstatt, die sich den Schwerpunkten "Öffentlicher Raum und Infrastruktur" widmet und in der Berliner Akademie der Künste stattfindet.
Am Vorabend versammeln sich rund 200 Gäste im Stattbad Wedding, das als Ort für Veränderung in der Stadtinfrastruktur steht, um sich auf die Baukulturwerkstatt einzustimmen.
Die Diskussion mit Vertretern unterschiedlicher Planungsdisziplinen und zahlreicher Kommunen verdeutlicht die Herausforderungen, denen sich unsere Städte und Regionen angesichts des ökologischen Umbaus zukünftig stellen müssen. Die Mobilität wird postfossil und individueller. Die auf Autos ausgerichtete Stadt wird zurückgebaut, während Freiräume vielfältiger genutzt werden. Dazu kommt, dass der Investitionsrückstand in der Verkehrsinfrastruktur 2014 auf 128 Milliarden Euro beziffert wird.
Engelbert Lütke-Daldrup, Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt und ehemaliger Geschäftsführer der Internationalen Bauausstellung IBA Thüringen, betont gleich zu Beginn, dass sich die Städte integrationsfähig präsentieren müssen. Nicht zuletzt eine wachsende Zuwanderung werde neue Anforderungen an kostengünstigen Wohnraum, eine funktionierende Infrastruktur und langfristig flexible Stadträume stellen. Weil der öffentliche Raum nicht nur Verkehrsträger, sondern auch Aufenthaltsort ist, sei eine Bürgerbeteiligung insbesondere zur Legitimation von Planungszielen unerlässlich. Um eine gesamtgesellschaftliche Relevanz zu erzielen, müsse sich die Bürgerbeteiligung jedoch verändern, da sonst immer kleinere, doch medial lautstarke Interessengruppen gehört würden. Der energetische Umbau müsse anstelle von Leuchtturmprojekten zukünftig die Quartiersebene und die Vernetzung in den Fokus nehmen. Dabei könne die Architektur Beispiele liefern, wie es die IBA in Hamburg-Wilhelmsburg geleistet habe. Baukulturell wertvolle Substanz dürfe nicht durch die energetische Optimierung beeinträchtigt werden.
Keine Veränderung solle ohne Verbesserung stattfinden, formulierte es Prof. Manfred Hegger von der Technischen Universität Darmstadt. Dass die erforderlichen Verhaltensänderungen keine Beschränkungen sein müssen, zeige etwa der von vielen Großstadtbewohnern als befreiend empfundene Verzicht auf das private Auto. Insbesondere Wasser spiele im Zusammenspiel mit dem öffentlichen Raum eine besondere Rolle, weil es ein archetypisches Siedlungselement ist und nach wie vor Menschen anzieht. Es gebe durch Klimawandel und Hochwasser aber auch Bedrohungen. Bei der Integration von Wasser in die Entwicklung städtebaulicher Konzepte und bei Stadtumbaumaßnahmen gebe es noch großen Handlungsbedarf. Die ausufernde Normierungskultur von Gesetzen, Verordnungen und DIN-Normen sowie das isolierte Betrachten einzelner Aspekte hätten die Planung in eine Sackgasse geführt und verhinderten die Umsetzung städtebaulicher Ideen, so die dramatische Feststellung, die auch Bestandteil des Baukulturberichts 2014/15 ist. Vielerorts sei neues Wohnen in der Stadt nicht realisierbar, da Lärmschutzverordnungen es einschränkten.
Obwohl die durchmischte Stadt offiziell gewünscht sei, drohe eine Verschärfung der Funktionstrennung, die man eigentlich überwinden wolle, so Architekt und Stadtplaner Thomas Sieverts. Die Beispielprojekte für die Konversion überdimensionaler Verkehrsflächen, für die Nutzbarmachung wassertechnischer Anlagen für den Stadtraum, für die energetisch optimierte Quartiersentwicklung oder für die Mobilität von morgen liefern vielversprechende Ausblicke. Offenkundig können diese Herausforderungen mit der bisherigen Planung jedoch nicht bewältigt werden.
Die Werkstatt 2 „Öffentlicher Raum und Infrastruktur“ fand in Kooperation mit der Akademie der Künste statt. Partner der zweiten Werkstatt waren der Bund deutscher Landschaftsarchitekten (BDLA), die Bundesingenieurkammer (BINGK), die IBA Thüringen , die Bundesvereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure (BSVI), der IGA Berlin 2017 , die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) sowie unsere Medienpartner Garten + Landschaft und Stadtaspekte.
Programm
Fr 28. März 2014, 20–23 Uhr
Offener Empfang
Stattbad Wedding, Gerichtstraße 65, Berlin
Sa 29. März 2014
Werkstatt 2 Öffentlicher Raum und Infrastruktur
Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, 10557 Berlin
09 Uhr
Einlass und Akkreditierung
10 Uhr
Begrüßung
Michael Bräuer, Direktor der Sektion Baukunst, AdK
Andrea Gebhard, Präsidenten des bdla
Hans-Ullrich Kammeyer, Präsident der BIngK
Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender Bundesstiftung Baukultur
10.15 Uhr
Baukultur-Barometer, Reiner Nagel
10.35 Uhr
Keynote: Herausforderungen für die Zukunft unserer Städte und Regionen, Prof. Engelbert Lütke Daldrup
11–12.30 Uhr
Projektvorstellungen / Teil 1
Energie
P01 Räumlich-energetisches Leitbild für ein CO2-neutrales Wilhelmsburg; Prof. Manfred Hegger, HHS Architekten; Uli Hellweg, IBA Hamburg
P02 Neue Energien für die Mobilität der Zukunft und die Konsequenzen für den öffentlichen Raum; Florian Lennert, InnoZ Innovationszentrum
Verkehr & Konversion
P03 Reparatur der autogerechten Stadt – das Beispiel Pforzheim; Gert Hager, Oberbürgermeister Stadt Pforzheim; Prof. Hartmut Topp, topp.plan: Stadt. Verkehr. Moderation; Michael Wolf, Stadtplanungsamt Pforzheim
P04 Park am Gleisdreieck, Berlin; Leonard Grosch, Atelier Loidl; Christoph Schmidt, Grün Berlin GmbH / IGA GmbH
12.30–13.30 Uhr
Lunch
13.30–14.10 Uhr
Projektvorstellungen / Teil 2
Öffentlicher Raum & Wasser
P05 Hochwasserschutz und Mainufergestaltung Würzburg; Prof. Christian Baumgart, Baureferat Stadt Würzburg; Christoph Klinkott, Klinkott Architekten Karlsruhe
P06 Pilotanlage Luritec / Spree 2011; Ralf Steeg, LURI.watersystems
P07 Klimaanpassung und lebendige Städte; Dieter Grau, Atelier Dreiseitl
14.20–15.45 Uhr
Werkstatt-Diskussionen mit den Referenten
1: Energie (P01 und P02) mit Matthias Rudolph, Transsolar Energietechnik
Moderation: Prof. Julian Wékel, TU Darmstadt
2: Verkehr & Konversion (P03 und P04) mit Prof. Christiane Thalgott, Stadbaurätin i. R.
Moderation: Konrad Rothfuchs, BSVI
3: Öffentlicher Raum & Wasser (P05 – P07) mit Andrea Gebhard, bdla
Moderation: Franziska Eidner, Einsateam
15.45–16.15 Uhr
Pause
16.15–17.00
Bericht aus den Werkstätten
Moderatoren und Kommentatoren: Prof. Julian Wékel, Konrad Rothfuchs, Franziska Eidner, Dr. Anne Schmedding
Lessons Learned, Reiner Nagel
Hauptmoderation: Kathrin Erdmann, NDR
Dokumentation
Impressionen
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
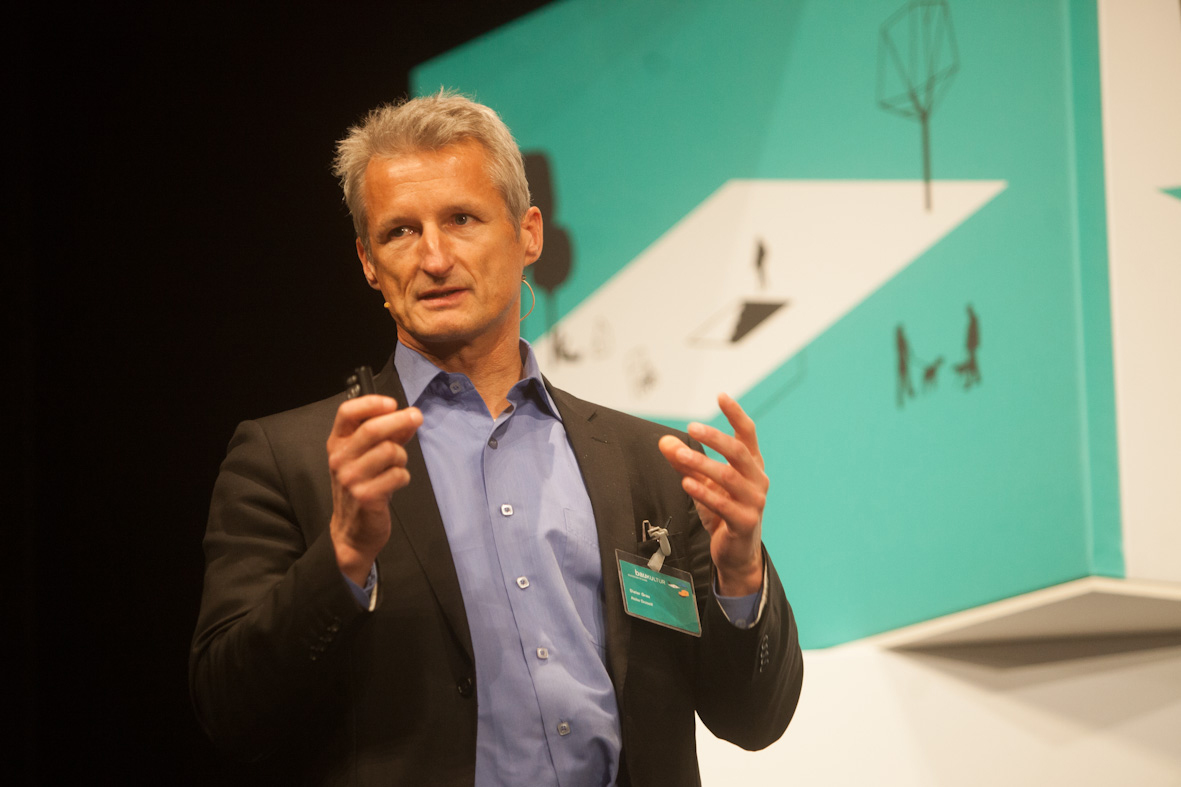 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
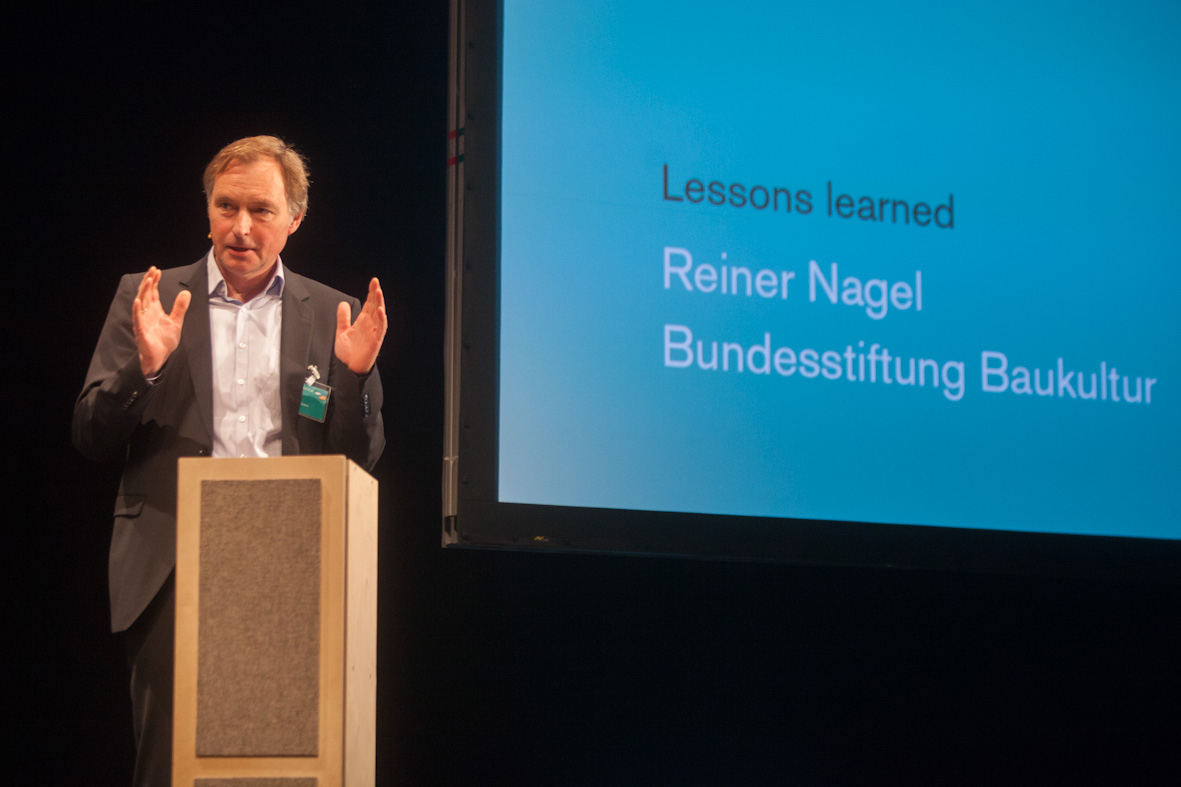 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
 © Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
© Till Budde für die Bundesstiftung Baukultur
Video-Dokumentation
